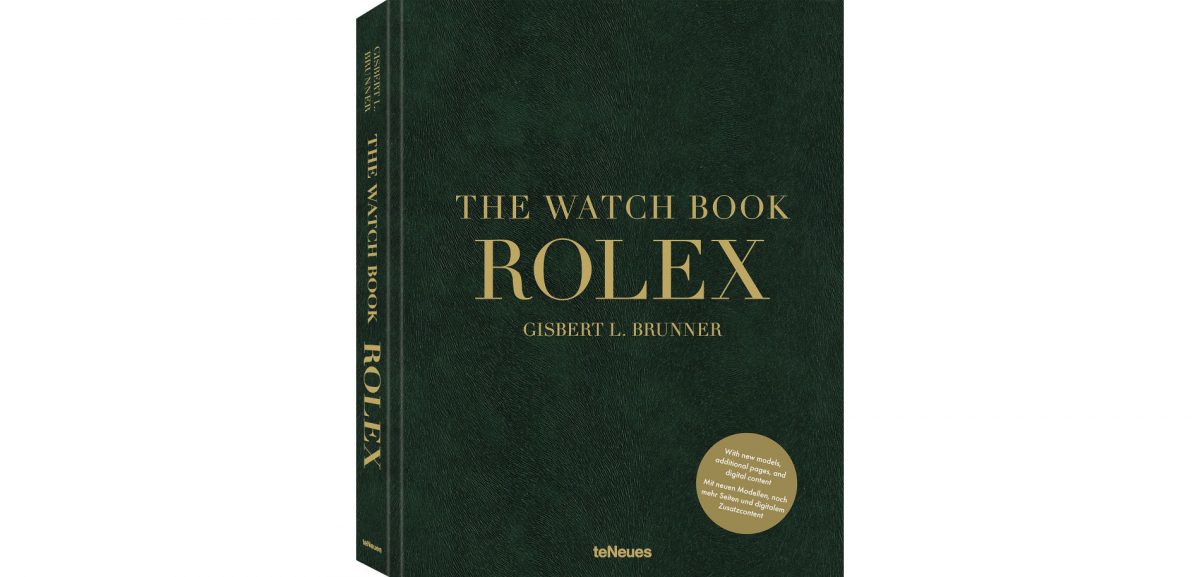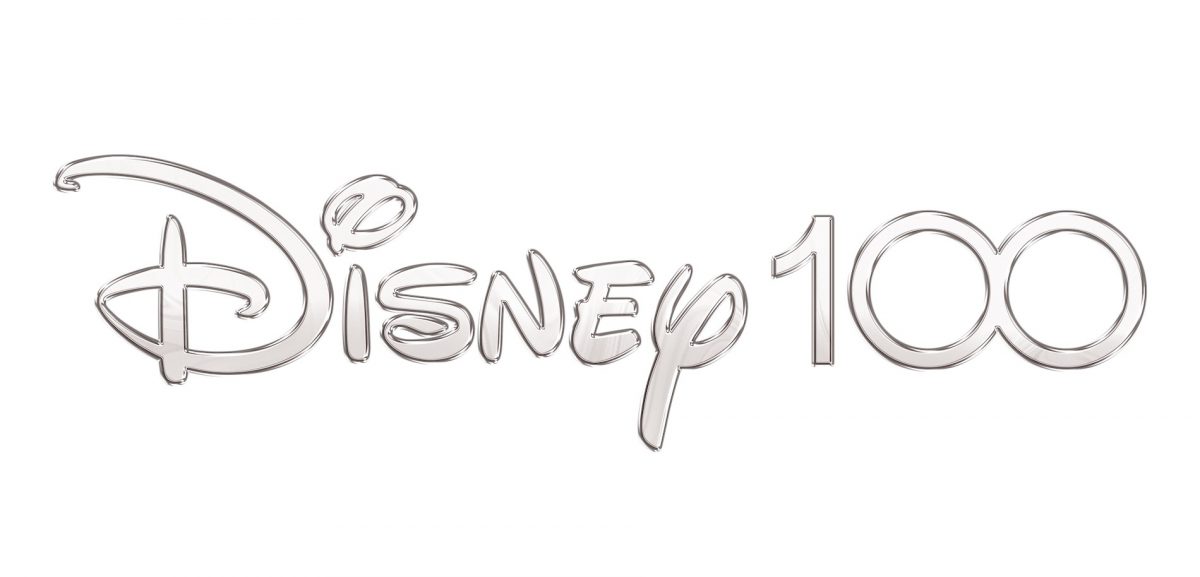Eine Coke ist eine Coke, erklärte einst Andy Warhol in Gertrude-Stein-Manier. Tatsächlich kommt man mit keinem Geld der Welt an eine Coke, die besser ist als jene, die der „Gammler an der Ecke“ trinkt, wie der große amerikanische Gelegenheits-Philosoph sich ausdrückte. Mit dem Gegenstand unserer neuen Folge von Design für die Ewigkeit verhält es sich im Prinzip sehr ähnlich. Obschon aufgedruckte Zauberworte oder aufgestickte Embleme manches T-Shirt in einen vermeintlichen Wertgegenstand verwandeln, ist das ursprünglich reine Unterhemd heute das demokratische, klassenlose Kleidungsstück schlechthin. Sind deshalb alle T-Shirts (gleich) gut, wie Warhol das von sämtlichen Cokes behauptet hat?
Das T-Shirt als logische Wahl
Wir widmen uns der qualitativen Frage in einem Augenblick. Rekapitulieren wir zuvor kurz die Geschichte des T-Shirts. Sie beginnt mit rein praktischen Erwägungen, weit jenseits vom heutigen Modezirkus oder kulturellen Statements. Wie bei der Jeans hatte der US-Bergbau Anteil am Siegeszug des maximal zwanglosen Textils. In der Hitze des Stollens war es ganz einfach unerträglich, irgend etwas anderes zu tragen. Das galt freilich gleichermaßen für zahlreiche weitere körperlich anstrengende Berufe des frühen Industriezeitalters. Allerdings muss festgehalten werden, dass das T-Shirt zu Beginn, also im 19. Jahrhundert, kein eigenständiges Kleidungsstück war, sondern der abgetrennte obere Teil der damaligen einteiligen Unterbekleidung.
Das 20. Jahrhundert brachte dann die Emanzipation und Aufwertung der preiswerten und pflegeleichten Baumwollhemden zu einem vollwertigen Stück Oberbekleidung. War das weiße T-Shirt bereits vor dem Ersten Weltkrieg zum Ausrüstungsgegenstand der US-Marine geworden, zeigten sich darin wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sogar erstmals US-Präsidentschaftskandidaten. Historisch betrachtet nicht unpassend, wenn man weiß, dass das Wort „Kandidat“ von der „toga candida“ stammt – dem weißen Gewand, in dem sich Amtsbewerber im antiken Rom dem Volk präsentierten.
… denn sie wissen nicht, was sie tun
Mindestens so wichtig wie seine funktionalen Vorzüge war für den Aufstieg zur Uniform des Freizeitmenschen die cineastische Nobilitierung, die das T-Shirt am Leib von Stars wie Marlon Brando und James Dean erfuhr. Ein banales Stück Stoff wurde hierdurch zum Symbol für Aufbegehren, Freiheit und relative Individualität. Zur Kehrseite des milliardenfachen Erfolgs passt der deutsche Titel eines der prägendsten Filme dieser Zeit. Er lautet „… denn sie wissen nicht, was sie tun“. Das T-Shirt ist nämlich – um zu der anfangs aufgeworfenen Frage zurückzukehren – von Ausnahmen abgesehen zum bedeutenden Faktor bei der weltweiten Ressourcenverschwendung und Umweltverschmutzung geworden.
Hier genau trennt sich die Spreu vom Weizen. Gut ist das T-Shirt, sofern es möglichst lange getragen und nicht als Einwegartikel betrachtet wird. Noch besser ist es, wenn seine Herstellung ohne Pestizide und andere Gifte erfolgte und es frei ist von Synthetikfasern. Sie gelangen mit jeder Wäsche in Gewässer und über Umwege in den menschlichen Körper, wie die Forschung gezeigt hat. Mit weitgehend unklaren Konsequenzen.
Das bessere T-Shirt entsorgt sich selbst
So berechtigt es ist, das T-Shirt als Design für die Ewigkeit zu betrachten, so wenig von Dauer ist leider jedes einzelne Exemplar. Selbst das am heißesten geliebte Erinnerungsstück an einen Traumurlaub oder ein mitreißendes Musikfestival dissoziiert sich mit der Zeit, schrumpft, bekommt Löcher und verliert gegebenenfalls den Print. Nur völlig in Luft lösen sich T-Shirts und ihr unsichtbarer Rucksack voller Probleme, den viele mit sich tragen, nicht auf. Neben den angesprochenen Synthetikfasern vermeintlich smarter Funktions-T-Shirts sind Textil- und Druckfarben für Färbung und Prints ebenfalls häufig alles andere als bioverträglich. Dass bestimmte Stoffe in der EU längst verboten wurden, hilft bei Importware nicht weiter.
Dass es anders geht, beweist Elkline. Das Hamburger Label bietet – wie von Head of Brand & Design Bettina Bothe im Rahmen unseres Designer-Fragebogens vor einiger Zeit angekündigt – inzwischen mit seinem kompostierbaren T-Shirt eine Alternative für diejenigen, die wirklich einen Unterschied machen wollen. Monomaterial Bio-Baumwolle, zu 100 Prozent biologisch abbaubare Drucke, der Verzicht auf Verpackungsmaterial und die faire Produktion in Europa sind die entscheidenden Stichworte. Wir meinen: Nachdem T-Shirts jahrzehntelang dafür herhalten mussten, Auskunft über die Gesinnung von Menschen zu geben, war es höchste Zeit, dass jemand mit ihnen selbst die Welt besser macht.

Weitere Informationen:
Elkline GmbH
www.elkline.de