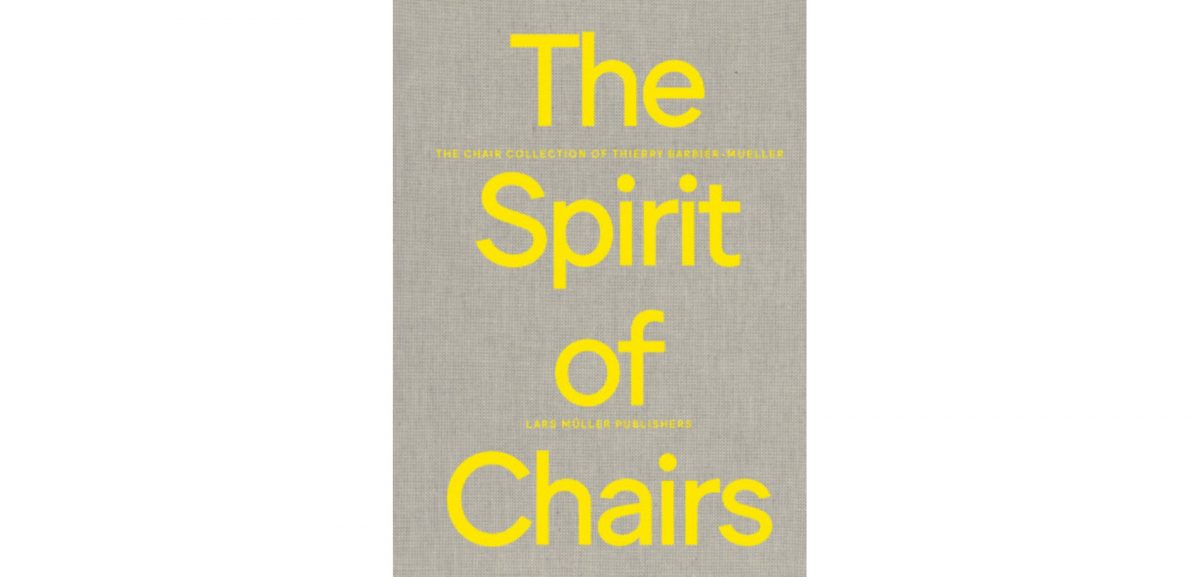Stellen Sie sich vor, man hätte Sie beauftragt, ein neuartiges physisches Schachspiel zu gestalten. Blenden wir für den Moment aus, dass Varianten in Hülle und Fülle existieren, für jeden Anlass und Zweck. Als da wären Tischschachspiele, Schachspiele für den Einsatz im Freien, auf Reisen; Spiele in den unterschiedlichsten Größen und aus den verschiedensten Werkstoffen. Holz, Stein, Metall et cetera. Nicht zu vergessen das legendäre aufblasbare Schwimm-Schach aus dem berühmt-berüchtigten Yps-Heft. Ein Bedarf an weiteren Schachspielen ist objektiv mithin nicht erkennbar. Allerdings hindert beispielshalber eine ähnliche Vielfalt an vorhandenen Modellen und Formen Möbelfirmen nicht daran, laufend neue Sofas, Sessel, Stühle und so weiter zu präsentieren …
Wie auch immer; Sie beginnen mit Vorüberlegungen, sammeln Inspiration und fertigen vermutlich erste grobe Skizzen an. Manche Einfälle werden Sie schnell wieder verwerfen. Andere schaffen es in die nächste Runde, wo es konkreter wird. Was Ihnen schon in der frühesten Phase auffällt, sind die vielen Vorbedingungen und Festlegungen, die Sie in Ihrer Kreativität einschränken. Natürlich ist man im Design niemals ganz frei. Am Beispiel Schach lässt sich gut veranschaulichen, mit welchen unterschiedlichen Zwängen man es abgesehen von speziellen Vorstellungen und Wünschen der Auftraggebenden zu tun bekommen kann. Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wohin das führt.
Wenig Raum zur Entfaltung
Wie bei jedem seriösen Designprojekt ist auch bei der Gestaltung eines Schachspiels das Verhältnis zwischen Form und Funktion maßgeblich. Die vorgesehene Verwendung beeinflusst bis ins kleinste Detail die Ausformulierung. In unserem Beispiel wird das Ganze in untypischer Weise überlagert durch ein Regelwerk, das Ihre Entscheidungen zusätzlich einengen wird. Wer ein Sitzmöbel entwirft, entkommt zwar ebenso wenig dem Zwang, dass das finale Produkt mindestens über eine Sitzfläche verfügen muss, die von irgendetwas anderem getragen wird. Mit welchen und wie vielen Elementen das realisiert werden soll, ist indes selten im Vorfeld haarklein festgelegt. Grenzen setzen hier hauptsächlich die Physik, die menschliche Anatomie sowie die für die Kostenkalkulation wichtigen Fragen des konstruktiven Aufwandes und der Materialauswahl.
Beim Schachspiel ist die Ausgangssituation eine andere. Allein das Schachbrett lässt wegen der Vorgabe, dass es aus einem Schachbrettmuster aus exakt acht mal acht Feldern zu bestehen hat, wenig Raum zur freien Entfaltung. Und das, obwohl es die Bühne bildet für geschätzt 1043 mögliche Stellungen. Was für ein Paradox! Zur Einordnung zwei Vergleiche: Die Zahl der Sterne im sichtbaren Universum schätzt man auf „nur“ 7 x 1022, die Zahl der Zellen des menschlichen Körpers wird mit 1013 bis 1014 angegeben.

Eine gute Figur machen
Widmen wir uns nun den Schachfiguren und somit überschaubareren Zahlen, ohne dadurch dem engen Korsett der Festlegungen zu entkommen. Stets müssen es 32 sein, in sechs verschiedenen Formen. Ein eindeutiges gemeinsames Merkmal teilt sie in zwei Gruppen à 16 Figuren. Sogar bei maximaler Freiheit und der wahrscheinlich damit verbundenen deutlichen gestalterischen Abweichung von offiziellen Turnierschachspielen sind das eine Menge zusätzlicher Determinanten, die Ihren Spielraum in Bezug auf die Formgebung von Bauer, Springer, Läufer, Turm, Dame und König begrenzen.
Zwischendurch eine Frage: Mögen Sie eigentlich Schach? Falls nicht, tröstet es Sie möglicherweise, dass die Herausforderungen im Zusammenhang mit Ihrem Auftrag bloß zum Teil spezifisch sind für das Sujet. Die meisten haben mit der Wahrnehmung und der Art und Weise zu tun, wie Menschen mit Objekten interagieren. Hat man diese Grundsätze verinnerlicht, wird man leichter zu angemessenen Lösungen kommen hinsichtlich der Formen, Abmessungen, Proportionen, Materialien und Oberflächen. Um die Betrachtungen nicht ausufern zu lassen, beschränken wir uns im Folgenden zunächst auf eine Unterkategorie des letztgenannten Punktes: die für das Schachspiel so wichtige Farbgebung.
Schach und Styling – verträgt sich das?
In einem anderen Kontext haben wir zuvor aufgezeigt, dass es gelegentlich sinnvoll ist, das Rad neu zu erfinden. Sollte das für das Schachspiel ebenfalls gelten? Das moderne Schach existiert seit einem halben Jahrtausend. Die Präferenz für einen maximalen Farb- respektive Helligkeitskontrast zur Unterscheidung der Schachfiguren in zwei Gruppen hat sich bestens bewährt. So sehr, dass es einerlei ist, welche Farben Sie Ihren Figuren verpassen. Man wird trotzdem von Weiß und Schwarz sprechen. Kann es überhaupt eine bislang unentdeckte, noch überzeugendere Designlösung geben? Hätten Sie einen Vorschlag?
Irgendwo an der Trennungslinie zwischen ernsthaftem Design und reinem Styling sind die optisch durchaus reizvollen farblosen Glasfiguren-Sets angesiedelt, bei denen eine Hälfte aus opakem und die andere Hälfte aus klarem Glas gearbeitet ist. Mehr Minimalismus geht nicht. Anderenfalls wird das bereits erschwerte unmittelbare Erfassen gänzlich unmöglich. Für echte Schachprofis ist das im Prinzip unproblematisch. Nötigenfalls improvisieren sie mit Salz- und Pfefferstreuer, Gläsern und allerlei anderen Gegenständen auf einem karierten Tischtuch. Ohnehin brauchen sie Brett und Figuren nicht einmal zu sehen, um eine Partie zu überblicken. Das sogenannte Blindschach beweist es.
Less is more
Schach spielen ohne ein Schachspiel zu verwenden – konsequenter lässt sich die von Ludwig Mies van der Rohe bekannt gemachte Idee des „Less is more“ nicht umsetzen. Ganz so weit dürfen Sie beim Verfolgen eines minimalistischen Ansatzes selbstverständlich nicht gehen. Ihren Auftrag wären Sie sonst los. Stattdessen könnten Sie versuchen, die typische Formensprache der Schachfiguren zu vereinfachen. Im Extremfall ließe sich so ein Spiel entwerfen, bei dem sämtliche Figuren dieselbe Grundform aufweisen. Ihre Oberseiten würden vielleicht Symbole tragen, die Aufschluss darüber geben, um welche Figur es sich jeweils handelt.

Zur Vermeidung von Missverständnissen sei betont, dass dieser Einfall keineswegs neu ist oder als besonders originell verstanden werden soll. Es geht lediglich darum, im Rahmen unseres Gedankenexperiments einige Dinge zu verdeutlichen. Auf die beschriebene Weise könnte man sich im Designprozess darauf konzentrieren, eine optimale einheitliche Form für alle Figuren zu identifizieren. Womit wir wieder bei den vordem unberücksichtigt gelassenen Faktoren wären: Abmessungen, Proportionen und Materialien. In Verbindung mit der Oberflächenbeschaffenheit – diesmal im Dienste der Haptik – ergibt sich nebenbei die Chance, an der Barrierefreiheit zu feilen. Ein absolutes Negativbeispiel sind die winzigen Steckfiguren von Reiseschachspielen, die ein fast akrobatisch zu nennendes feinmotorisches Geschick verlangen.
Kein Schachmatt
Zeit für ein Fazit. Was konnte an unserem Schach-Beispiel gezeigt werden? Wie man trotz eng gesetzter Grenzen neue Lösungen findet? Sicherlich. Zumindest ein Stück weit. Denn die richtigen Probleme kommen erst in der Praxis. Ein denkbarer Anwendungsfall ist übrigens die Weiterentwicklung eines etablierten Produktes mit allseits bekannten, stark ausgeprägten Merkmalen. Dem Schachspiel entspräche in dem Fall etwa der nächste VW Golf oder das kommende iPhone. Derartige Projekte erfordern zumeist sehr viel Behutsamkeit. Evolution statt Revolution und Tabula rasa. Man will seine Cashcow schließlich nicht zur Schlachtbank führen.
Noch ein anderer Aspekt verbindet die gestalterische Praxis mit dem Gegenstand unseres Beispiels, dem Schachspiel selbst. Dieses lehrt und trainiert bekanntermaßen das Antizipieren und das Denken in großen Zusammenhängen. Zeitlich und kausal. Dazu passt zum einen, dass sich zunehmend das Verständnis durchsetzt, dass Design heute in kompletten Lebenszyklen gedacht werden muss. Und zum anderen, dass man in Unternehmen hinter den Kulissen normalerweise längst an der übernächsten Produktgeneration arbeitet. Mitunter gar an der Disruption des eigenen Produktes, um Mitbewerbern zuvorzukommen. Natürlich nicht als ein selbstverschuldetes Schachmatt, sondern im Sinne eines Game Change.
Bleiben wir aber lieber beim königlichen Spiel: Kann nach all unseren Überlegungen noch bezweifelt werden, dass Schach für das Design allergrößte Relevanz besitzt?
Ist Ihnen nach dem Lesen eine Designidee gekommen oder noch etwas anderes eingefallen, das Designende vom Schach lernen können? Schreiben Sie uns, wir freuen uns auf Ihre Nachricht.